Die Zukunft des Liquid Restaking
Im letzten Modul werden die nächsten Entwicklungsschritte skizziert. Das Modul stellt den EigenLayer-Fahrplan vor, erläutert Multichain-Restaking mit Protokollen wie Symbiotic und stellt innovative Anwendungsbeispiele außerhalb der Middleware vor – insbesondere modulare Rollups, dezentrale KI-Netzwerke und Bitcoin-Restaking. Darüber hinaus verdeutlicht das Modul, wie Restaking zu einem grundlegenden, kettenübergreifenden Sicherheitsmechanismus heranreift und wie Entwickler und Anwender sicher an der kommenden Entwicklungsphase dieses Ökosystems mitwirken können.
Slashing und technisches Risiko
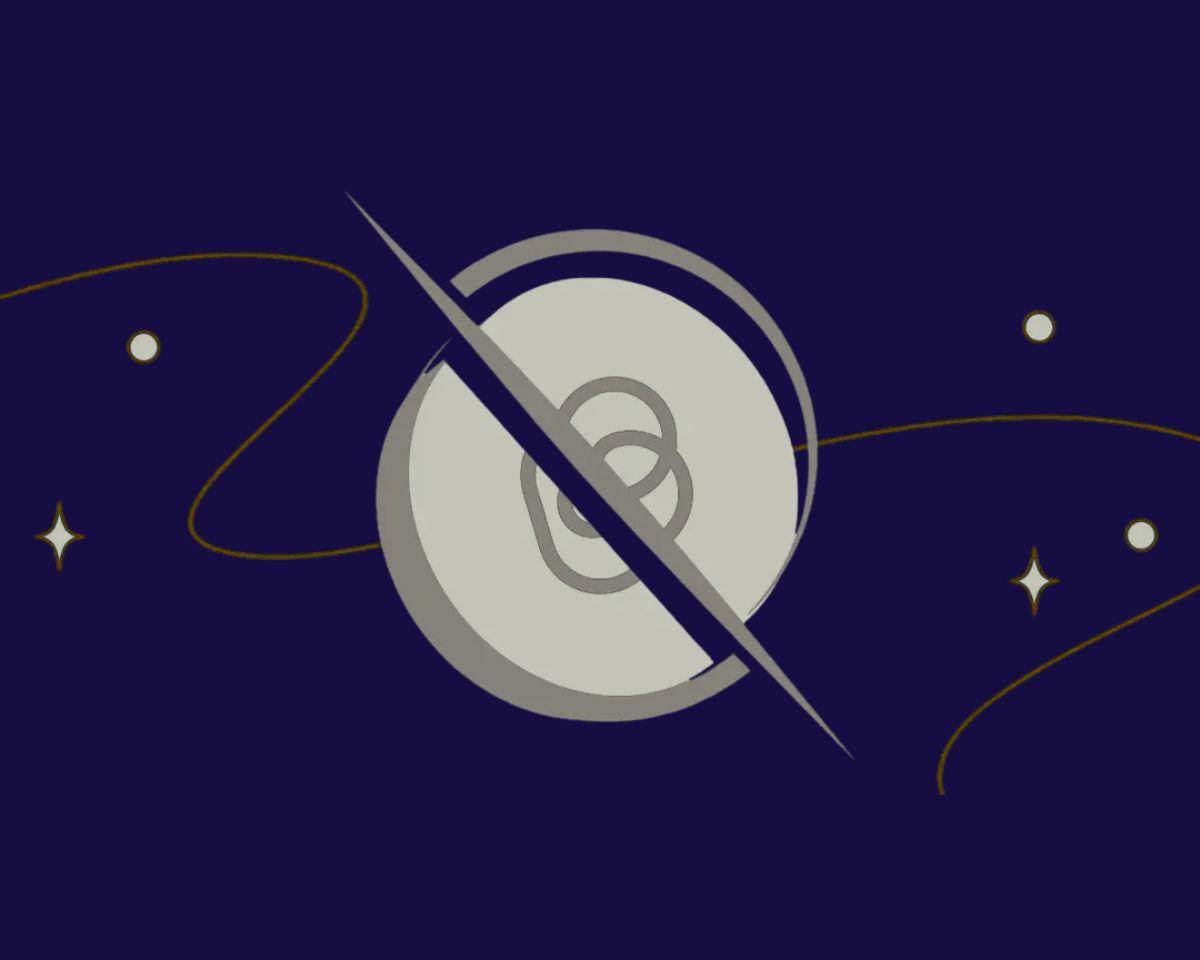
Eines der wesentlichen Risiken beim Restaking ist das Slashing. Im herkömmlichen Ethereum-Staking tritt Slashing nur selten auf und beschränkt sich auf klar definierte Fälle wie Doppelsignaturen oder längere Inaktivität im Netzwerk. Beim Restaking entscheiden sich Validatoren jedoch bewusst dafür, zusätzliche Dienste – sogenannte aktiv validierte Services (AVSs) – abzusichern. Jeder dieser Dienste legt eigene Slashing-Bedingungen fest. Diese werden nicht mehr durch das Ethereum-Protokoll, sondern von den AVSs selbst bestimmt, oftmals mithilfe von Smart Contracts oder außerhalb der Blockchain definierten Regeln.
Dies führt zu einer größeren Bandbreite an Risiken und eröffnet neue Angriffsflächen. Ein Validator kann unbeabsichtigt gegen die Regeln eines AVS verstoßen – nicht aus böswilliger Absicht, sondern beispielsweise wegen Fehlkonfigurationen, Softwarefehlern oder widersprüchlichen Delegationen. Da LRTs delegierte Positionen über diverse AVSs hinweg bündeln, kann ein Slashing-Ereignis in einem Dienst den Wert, die Reputation und die Besicherungsqualität des Tokens im gesamten DeFi-Bereich beeinträchtigen.
EigenLayer begegnet diesem Problem ab 2025 teilweise mit On-Chain-Slashing-Modulen – sie sorgen für transparente, überprüfbare Slashing-Bedingungen und programmierbare Durchsetzung. Das Grundproblem bleibt jedoch bestehen: LRT-Nutzer sind indirekt Risiken ausgesetzt, die aus Diensten resultieren, welche sie oft nicht vollumfänglich nachvollziehen oder überwachen. Ohne Echtzeit-Einblick in das Verhalten der Validatoren und laufende Änderungen in den AVS-Regeln erhöht das Restaking-Modell die technische Intransparenz – ein Risiko, das im klassischen Single-Layer-Staking nicht existierte.
Weiterhin berücksichtigen die meisten DeFi-Protokolle in ihren Risikomodellen keinen Unterschied zwischen LSTs und LRTs. Wird ein LRT als Sicherheit oder zur Prägung von Stablecoins verwendet, kalkuliert man vielfach nur das Basisschicht-Ethereum-Risiko ein, obwohl immer auch externe Slashing-Gefahren bestehen. Diese Fehleinschätzung kann zu zu niedrigen Liquidationsschwellen führen und das Risiko von Kettenreaktionen in Extremsituationen erhöhen.
Abhängigkeiten von Smart Contracts und Oracles
LSTs und LRTs stützen sich maßgeblich auf Smart Contracts, um Staking-Prozesse, Tokenemissionen, Restaking-Delegationen und die Verteilung von Erträgen zu steuern. Eine Schwachstelle in einem dieser Elemente kann zu massiven systemischen Problemen führen. So könnte etwa eine Lücke in der Auszahlungslogik eines LRT-Protokolls oder im Delegationsvertrag unautorisierte Rücknahmen oder fehlerhaftes Verhalten von Validatoren ermöglichen.
Dieses Risiko potenziert sich, wenn LRTs in mehreren DeFi-Protokollen eingesetzt werden. Ein Fehler in einem Protokoll kann drastische Auswirkungen haben, wenn der Token zugleich anderswo als Sicherheit dient oder als Basis für Stablecoins fungiert. Die hohe Vernetztheit im LRT-Fi-Bereich schafft Kettenabhängigkeiten, die das Schadensausmaß eines einzelnen Fehlers erheblich vergrößern können.
Oracles spielen hierbei eine zentrale Rolle, gerade bei Protokollen wie Pendle oder auf Kreditplattformen, bei denen LRT-Bewertungen marktbezogen erfolgen. Wird ein Oracle manipuliert oder fällt es aus, können Nutzer zu falschen Preisen liquidiert werden – das treibt die Marktvolatilität. Wo Prognosen, wie etwa EigenLayer AVS-Erträge, von Oracles abhängen, kann die Fehleinschätzung zu falschen Renditeerwartungen oder Fehlpreisen für restakte Assets führen.
Obwohl Protokoll-Audits, formale Verifizierung und On-Chain-Monitoring sich verbessert haben, macht die Komplexität von LRT-Strukturen es schwierig, das Smart-Contract-Risiko völlig auszuschließen. Mit wachsendem Ökosystem könnten gemeinsame Risikoregister und offene Slashing-Warnsysteme notwendig werden, um Protokollübergreifend Risiken zu koordinieren und systemische Ansteckungen zu verhindern.
Zentralisierungsrisiko und Konzentration bei Betreibern
Das Erfolgsversprechen des Ethereum-Staking liegt in der Dezentralisierung: Tausende unabhängige Validatoren sorgen für die Netzwerksicherheit. Beim Liquid Staking sind jedoch bereits Zentralisierungseffekte spürbar – etwa, weil Plattformen wie Lido große Marktanteile erobert haben. Restaking verschärft diese Tendenzen zusätzlich. AVSs neigen dazu, etablierte und gut kapitalisierte Betreiber für mehr Sicherheit zu bevorzugen, sodass sich Delegationen auf wenige Node-Betreiber konzentrieren.
Im LRT-Ökosystem tritt diese Konzentration noch stärker zutage. Die meisten LRT-Anbieter arbeiten mit ausgewählten Validatoren-Pools, und diese Validatoren nehmen häufig an mehreren AVSs teil. Kommt es zu einem Fehlverhalten eines dominanten Validators, können dadurch gleichzeitig mehrere Protokolle, LRTs und AVSs betroffen sein – das Risiko korrelierter Slashing-Ereignisse steigt deutlich.
EigenLayer begegnet dem, indem es offene Delegationsmärkte bietet und AVSs eigene Auswahlkriterien für Validatoren definieren lässt. Dennoch bleibt die fehlende Dezentralisierung innerhalb der LRT-Betreiber ein kritischer Punkt. Ohne eine breitere Beteiligung droht das Restaking-Modell die zentralen Schwächen zu wiederholen, die es eigentlich beseitigen wollte: Das Vertrauen konzentriert sich auf wenige Akteure, die Milliardenwerte für tausende Nutzer verwalten.
Diese Konzentrationsrisiken sind für DeFi-Protokolle, die LRTs integrieren, strategisch bedeutsam. Setzen mehrere Plattformen auf dasselbe LRT als Sicherheit oder Renditequelle, kann ein Ausfall auf Betreiber- oder Protokollebene Dominoeffekte im gesamten System auslösen: Liquidationen, Kurseinbrüche oder Vertrauensverlust in die Staking-Infrastruktur drohen.
Regulatorische Unsicherheit und juristische Einordnung
Das mit Abstand größte externe Risiko für LRT- und LST-Protokolle ergibt sich aus der Regulierung. In vielen Ländern ist der rechtliche Status von Staking-Derivaten, renditegenerierenden Tokens und modularen Finanzprodukten bislang nicht abschließend geklärt. Aufsichtsbehörden in den USA, der EU und Asien haben verstärkte Kontrolle von Staking-Diensten angekündigt – vor allem, wenn Tokenisierte Varianten an Privatanleger ausgegeben werden oder zusätzliche Renditeversprechen enthalten.
LSTs könnten als indirekte Wertpapiere angesehen werden, wenn ihr Wert von der Validatoren-Performance Dritter abhängt und Anleger eine passive Rendite erwarten. LRTs erhöhen die Komplexität weiter, da sie delegiertes Restaking, Drittanbieter-AVS-Performance und mehrere Ertragsquellen kombinieren. Dieses gestaffelte Risiko erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Behörden betreffende Instrumente als nicht registrierte Wertpapiere oder strukturierte Finanzprodukte einstufen.
Zudem können neue Belohnungssysteme wie EigenLayer Points und die Vergabe von Protokoll-Tokens auf Basis der LRT-Nutzung als informelle, auf Airdrops basierende Anreize gelten, die Behörden als tokenisierte Vergütungsmodelle einstufen. Daraus ergeben sich Fragen zu Offenlegung, Lizenzierung und zum Anlegerschutz.
Als Reaktion darauf führen Protokolle zunehmend Geofencing, KYC-Beschränkungen und eine Fokussierung auf institutionelle Nutzer bei Restaking-Angeboten ein. Ohne eine weltweit einheitliche Regulierung für Staking-Derivate und DeFi-Produkte bleibt die Durchsetzung jedoch unvorhersehbar. Schon eine einzige Durchsetzungsmaßnahme gegen ein bedeutendes LRT-Protokoll könnte im gesamten DeFi-Bereich eine Risikoaversion auslösen – insbesondere bei Plattformen, die auf LRT-Besicherung oder Ertragsmechanismen angewiesen sind.
Ökonomische Nachhaltigkeit und Renditekompression
Das rasche Wachstum von LRT-Fi wurde durch Anreize für Early Adopter, Prämienkampagnen und optimistische Prognosen zu EigenLayer-AVS-Gebühren getrieben. Diese Renditeschichten sind jedoch nicht garantiert. Mit dem Eintritt weiterer Nutzer und der Verteilung der Prämien auf eine größere Basis sinken die individuellen Erträge voraussichtlich.
Bislang haben EigenLayer AVSs keine konstante Einnahmenerzeugung nachgewiesen, die mit den frühen Erwartungen mithalten kann. Die meisten AVSs operieren bislang ohne nachhaltige Einnahmen und stützen sich auf Zuschüsse oder Startanreize. Bleibt die wirtschaftliche Nachhaltigkeit aus, könnte das Restaking-Renditemodell aus einem spekulativen Konstrukt bestehen, das sich auf Punkte und Tokenzuteilungen stützt, anstatt auf reale, wiederkehrende Gebühren.
Zugleich stehen DeFi-Protokolle, die LRTs integrieren, vor der Herausforderung, attraktive Renditen zu bieten und gleichzeitig Slashing-Risiken zu kontrollieren. Das kann zu unterbesicherten Krediten, überhöhter Risikobereitschaft oder übermäßiger Ausgabe von Stablecoins führen, die auf volatilen oder illiquiden LRTs basieren. Bei Marktrückgängen könnten viele Nutzer gleichzeitig aussteigen wollen, was Liquiditätsengpässe und Abwärtsspiralen bei den Preisen nach sich ziehen würde.
Zur Verschärfung trägt die zunehmende Komponierbarkeit von LRTs bei. Wird derselbe Vermögenswert in zahlreichen Protokollen eingesetzt, kann jede Veränderung in seinem Wert oder seinem Sicherheitsprofil einen großflächigen Deleveraging-Prozess im DeFi-Sektor auslösen – ähnlich wie beim Zusammenbruch algorithmischer Stablecoins im Jahr 2022.
Für eine nachhaltige Zukunft von LRT-Fi sind echte Renditen aus AVSs, strenge Risikorahmen für Integrationen und eine präzisere Modellierung von Validatorenverhalten und Token-Ökonomie erforderlich. Fehlen diese Grundlagen, bleibt das System besonders anfällig für Regulierungsschocks und Marktturbulenzen.





