Der Aufstieg von LST-Fi und LRT-Fi
In diesem Modul wird untersucht, wie LRTs innerhalb unterschiedlicher DeFi-Protokolle eingesetzt werden. Das Modul zeigt praxisnahe Anwendungsfälle wie Rendite-Vaults, gehebeltes Staking, LRT-basierte Stablecoins und Rehypothezierung, wobei Plattformen wie Pendle, Gearbox, Prisma und Ethena als Beispiele dienen. Der Fokus dieses Abschnitts liegt darauf, wie LRTs in diesen Systemen zirkulieren und zusätzliche Ertragsschichten eröffnen. Außerdem werden neue Möglichkeiten für Komposabilität sowie Hebelwirkung geschaffen.
Definition von LST-Fi und LRT-Fi
LST-Fi bezeichnet Finanzaktivitäten rund um LSTs – Token, die gestaktes ETH oder andere Vermögenswerte repräsentieren und dennoch liquide bleiben. Diese Token erwirtschaften Staking-Belohnungen und können in DeFi-Protokollen genutzt werden, ohne dass Nutzer ihr Kapital entsperren müssen. LST-Fi begann mit einfachen Anwendungen wie dem Einzahlen von stETH in Kreditpools oder Liquiditätsfarmen, hat sich aber zu einem facettenreichen Ökosystem entwickelt: LSTs dienen heute als Sicherheiten, als Grundlage für die Ausgabe von Stablecoins und bilden Schlüsselelemente anspruchsvoller Renditestrategien.
LRT-Fi ist eine neuere Entwicklung, die auf LST-Fi aufbaut, indem sie Restaking-Logik integriert. LRTs sind komplexer als LSTs, da sie Kapital abbilden, das nicht nur Basis-Staking-Belohnungen generiert, sondern zusätzlich über EigenLayer oder andere Restaking-Protokolle dezentralisierte Dienste absichert. LRT-Fi führt restaking-spezifische Ertragsmechanismen ein, etwa AVS-Gebühren und EigenLayer-Punkte, die klassische DeFi-Erträge ergänzen. So entstehen gestaffelte Strategien, bei denen ein Token – je nach Einsatz – gleichzeitig drei oder mehr Arten von Erträgen generieren kann.
Die Unterscheidung ist essenziell, da sie unterschiedliche Risikoprofile und Ertragsquellen definiert. LST-Fi betrifft im Wesentlichen Konsensrisiken von Ethereum, während LRT-Fi durch aktiv validierte Dienste und Restaking-Verträge zusätzliche Risiken auf Anwendungsebene einführt. Daher behandeln Nutzer und Protokolle diese Vermögenswerte unterschiedlich, selbst wenn beide ähnliche Kompositionsmerkmale aufweisen.
Anwendung von LSTs und LRTs in DeFi
LSTs sind wegen ihrer berechenbaren Rendite, geringen Volatilität und starken Marktnachfrage fest in Kredit- und Handelsprotokollen verankert. So akzeptieren Aave und Compound stETH oder rETH als Sicherheit; Curve und Balancer bieten LST-basierte Pools, die Swaps zwischen LSTs, ETH und Stablecoins ermöglichen. Nutzer können dadurch Liquidität freisetzen, ohne ihre gestakten Mittel zu verkaufen, und weiterhin Staking-Erträge erzielen.
LRTs werden zunehmend auf ähnliche Weise genutzt. ezETH von Renzo und eETH von Ether.fi werden beispielsweise in Geldmärkten wie Gearbox und Morpho hinterlegt, wodurch Nutzer Stablecoins leihen oder ihre Positionen hebeln können. Bei Pendle werden LRTs in Principal-Token und Yield-Token aufgeteilt, sodass künftige Restaking-Erträge gehandelt oder feste Einkommensstrategien umgesetzt werden können. Manche Protokolle beginnen sogar, Stablecoins anzubieten, die vollständig durch LRT-Kollateral gedeckt sind; dabei verwenden sie die Vorhersagbarkeit von AVS-Erträgen für Langfristmodellierung und Einlöslogik.
Diese Anwendungen stehen für eine übergreifende Entwicklung im DeFi: Passives Staking-Kapital wird zu aktiv genutzten, ertragsstarken Finanzinstrumenten. Durch zusätzliche Ertragsschichten und modulare Kombinationsmöglichkeiten sind LSTs und LRTs heute unverzichtbare Bausteine für den Aufbau flexibler Renditeportfolios.
Fallstudien und Protokollbeispiele
Pendle
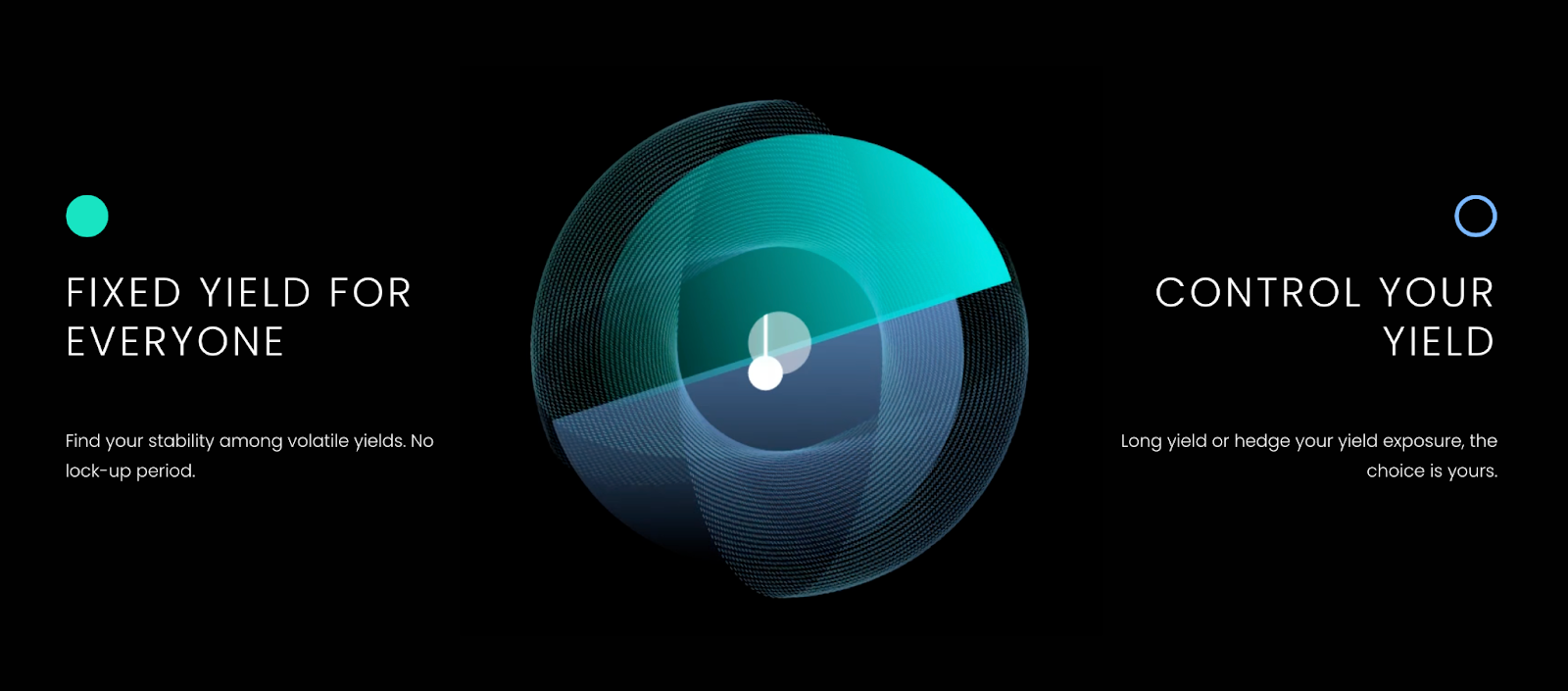
Pendle hat sich als einer der führenden Marktplätze für LRT-Fi etabliert. Nutzer hinterlegen LRTs und teilen sie in zwei separate Vermögenswerte: Principal-Token (PT) und Yield-Token (YT). PT steht für den Basiswert des LRT und fungiert wie eine Nullkuponanleihe, YT spiegelt künftige Restaking-Erträge und AVS-Gebühren wider. Diese Struktur schafft Raum für fortgeschrittene Strategien wie Fixed-Yield-Farming, spekulativen Handel mit Belohnungen oder gezielte Absicherung von Erträgen.
Gearbox

Gearbox integriert LRTs in gehebelte Kreditkonten. Nutzer können mit geliehenen Stablecoins Belohnungen farmen und gleichzeitig an restaked ETH partizipieren. Beispielsweise kann man ezETH als Sicherheiten hinterlegen, USDC leihen und mit beiden Vermögenswerten in einem risikoadjustierten Portfolio Staking-, Restaking- und DeFi-Anreize bündeln.
Prisma Finance
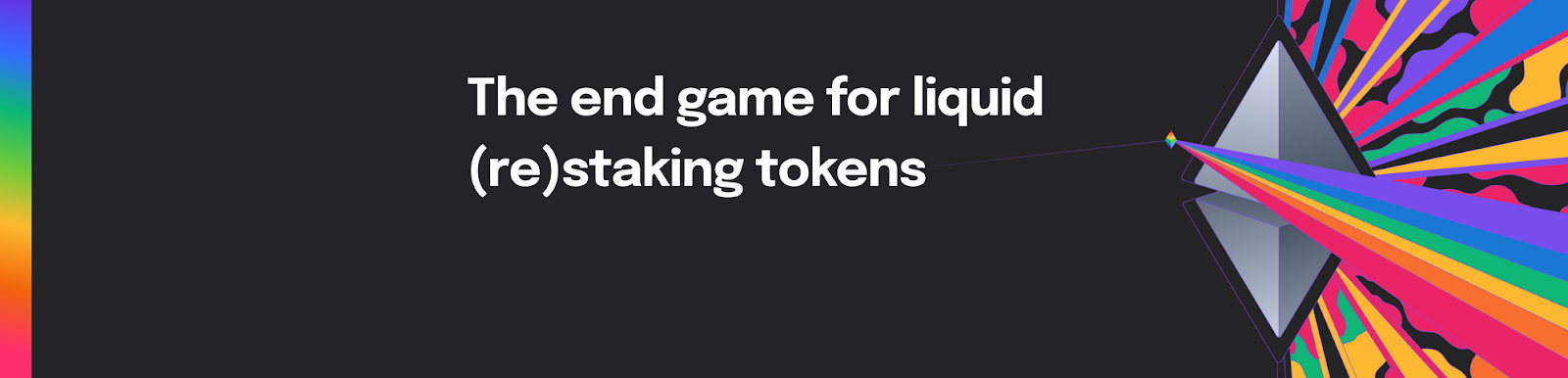
Prisma Finance hat ein Modell eingeführt, bei dem LRTs zur Prägung von Stablecoins genutzt werden – ähnlich wie MakerDAO ETH oder LSTs für die Deckung von DAI verwendet. Das erweitert den Anwendungsbereich von LRTs auf Stablecoins und erlaubt es, restaked Vermögenswerte als Basis dezentraler Liquidität einzusetzen.
Kelp DAO und Swell wiederum haben native DeFi-Integrationen von Anfang an in ihre LRT-Emission eingebettet. Nutzer können so ihre Token automatisch staken, restaken und in kuratierte DeFi-Vaults oder Indexprodukte einbringen – das schafft effiziente und automatisierte Renditeströme.
Die Initiative „Mint • Spend • Earn“ von Ether.fi steht für einen verbraucherorientierten Ansatz in LRT-Fi. Nutzer können eine Ausgabenkarte prägen, die durch restaked ETH gedeckt ist und weiterhin Staking- sowie EigenLayer-Belohnungen erwirtschaftet. So zeigt sich, dass solche LRT-Fi-Strategien längst nicht nur im institutionellen Bereich, sondern auch im Endkundensegment Anwendung finden.
Reward Stacking und das neue DeFi-Meta
Ein wesentlicher Grund für die Beliebtheit von LRT-Fi ist das Reward Stacking. Typischerweise erhalten Nutzer in LRT-Fi-Positionen zugleich Staking-Belohnungen von Ethereum, AVS-Anreize von EigenLayer und Punkte oder Airdrop-Zuteilungen von LRT-Emittenten. Werden diese Token dann in DeFi-Protokolle eingebracht, winken zusätzliche Protokollprämien, Zinsen oder Farming-Incentives.
Dieser Kaskadeneffekt ermöglicht ein hohes Renditepotenzial, vor allem wenn Protokolle Punkte-Kampagnen oder rückwirkende Belohnungssysteme auf bestehende Incentives aufsetzen. So kann das Einzahlen von ezETH bei Pendle dazu führen, Renzo-Punkte, Pendle-Punkte, EigenLayer-Punkte und Handelsgebühren parallel zu verdienen!
Dieses Modell hat ein neues DeFi-Meta rund um Restaking-Yield-Maximierung hervorgebracht. Es entstehen Communitys für Hochrendite-Strategien, Frontends zur Nachverfolgung mehrerer Belohnungen und Risikomodelle, die mehrere Token-Positionen gesamthaft betrachten.
Allerdings steigt mit dem Yield Stacking auch die Risikokomplexität. Nutzer sind verschiedenen Smart-Contract-Risiken, Protokoll-Governance-Änderungen und Slashing-Ereignissen auf AVS-Ebene ausgesetzt. Um die maximale Rendite herauszuholen, braucht es daher ein durchdachtes Management von Liquidität, Modularität und Volatilität über alle Ebenen hinweg.
Liquidität, Risikomanagement und Infrastruktur-Lücken
Trotz rasanten Wachstums befindet sich LRT-Fi weiterhin im Aufbau – mit einigen infrastrukturellen Hürden. Fragmentierte Liquidität bleibt ein Problem: Da jeder LRT an einen bestimmten Emittenten und Validatorensatz gebunden ist, fehlt es Sekundärmärkten oft an Tiefe, wie sie LSTs längst erreicht haben. Das beeinträchtigt Handelsmöglichkeiten und führt mitunter zu Preisunterschieden zwischen vergleichbaren LRTs.
Auch das Risikomanagement ist anspruchsvoll. LRTs bilden delegiertes Restaking-Exposure ab und tragen somit das Slashing-Risiko aus den AVSs von EigenLayer. Die meisten DeFi-Protokolle betrachten LRTs als erstklassiges Kollateral, doch fehlen vielfach Mechanismen, um auf Slashing-Ereignisse oder AVS-Ausfälle angemessen zu reagieren. Das kann systemische Risiken hervorrufen, wenn viele Protokolle denselben LRT nutzen, ohne Extremrisiken ausreichend abzudecken.
Interoperabilität ist bislang kaum gegeben. LRTs sind aktuell an das Ethereum-Mainnet gebunden. Obwohl Projekte wie Symbiotic kettenübergreifende Ansätze erproben, bleibt die LRT-Fi-Aktivität derzeit isoliert. Das Überführen von LRTs auf andere Chains oder Rollups erhöht die Komplexität, etwa durch Orakelabhängigkeiten und fragmentierte Governance.
Schließlich ist die Transparenz bezüglich Validatorenaktivität und Restaking-Strategien limitiert. Zwar bieten Protokolle Dashboards und detaillierte Ertragsdaten, doch erfahren Nutzer selten, welche AVSs ihr Kapital konkret absichern und mit welchen Risiken dies verbunden ist. Ein standardisiertes Reporting, transparente Validatorenbewertungen und klare AVS-Offenlegungen werden für nachhaltiges Wachstum entscheidend sein.





